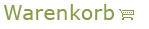Sonata à 4

Nach erstem musikalischen Unterricht bei Johann Drechsel und Gabriel Schütz in seiner Heimatstadt Nürnberg setzte Johann Philipp Krieger von ca. 1663 bis 1667 seine musikalischen Studien beim Königlich Dänischen Kammerorganisten Johann Schröder in Kopenhagen fort. Als „geschickter Vicario" (Mattheson) dürfte Krieger bei Johann Schröder einen gründlichen Unterricht in der polyphonen Satzkunst erhalten haben. Auf einer Studienreise nach Italien im Jahr 1672 komplettierte Krieger seine musikalische Ausbildung mit Unterricht u. a. bei Johann Rosenmüller in Venedig.
Kriegers Lebensleistung liegt mit über 2.500 nachweisbaren Kompositionen in der geistlichen Vokalmusik. Als Hofkapellmeister auf Schloss Neu-Augustusburg hatte Krieger neben seinem Dienst in der Kirche auch die Hofoper und alle musikalischen Festivitäten am Hof mit Musik zu versorgen. Sein Verzeichnis aller von ihm aufgeführten Werke (vgl. Klaus-Jürgen Gundlach: Das Weißenfeiser Aufführungsverzeichnis Johann Phillip Kriegers und seines Sohnes Johann Gotthilf Krieger [1684-1732], Sinzig 2001) weist eine ganze Reihe großer, zum Teil mehrchörig angelegter Instrumentalmusiken aus. Keine dieser Kompositionen ist überliefert. Erhalten geblieben sind die beiden gedruckten Sammlungen „XII. Suonate ä due Violini" op. 1, Nürnberg 1688 und „XII. Suonata ä doi, Violino a Va. da Gamba", op. 2 (Nürnberg 1693). Die "Lustige Feld-Music. Auf vier blasende oder andere Instrumenta gerichtet" (Nürnberg 1704) zählt zu den Kriegsverlusten (in Auszügen überliefert in: Johann Philipp Krieger, Partie F-Dur, hrsg. von Max Seiffert, Kistner & Siegel Co., Lippstadt, O.J.).
Die beiden gedruckten Sammlungen vermitteln einen unverkennbaren Personalstil, in welchem deutsche Kontrapunktik, konzertierender Stil und italienische Kantabilität zu einer Synthese verschmelzen. Die Triosonaten zählen neben den Instrumentalkompositionen von Dietrich Buxtehude und Johann Rosenmüller zu den bedeutendsten Zeugnissen deutscher Instrumentalmusik des 17. Jahrhunderts.
Die vorliegende Sonata ä 4 ist das früheste Zeugnis einer Instrumentalkomposition Johann Philipp Kriegers. Das einzige überlieferte Exemplar der Sonate ist in einer Handschrift des Stimmensatzes in der Universitätsbibliothek Uppsala überliefert. Am Schluss der Continuo-Stimme steht der Vermerk des Kopisten: „C. G. scr. Hafnia ms. Augusto." Dabei dürfte es sich um Christian Geist handeln, der sich von Mai 1669 bis 1670 in Kopenhagen aufhielt und als Bassist in der dänischen Hofkapelle sang. Hafnia ist die lateinische Bezeichnung der alten Handelsstadt Kopenhagen. Die Jahreszahl zum Monat August fehlt, ist aber, bedingt durch den Aufenthalt von Christian Geist in Kopenhagen, auf 1669 oder 1670 festzulegen. Ab 1663 (Doppelmayr) oder 1665 (Mattheson) studierte Johann Philipp Krieger bei Johann Schröder bis 1667 in Kopenhagen. Die Entstehungszeit der Sonate dürfte damit zwischen 1663 und 1667 liegen.
Die ungewöhnliche formale Gestaltung der Sonate weist auf den experimentierfreudigen jungen Komponisten hin: Ensemblesatz - ein Solo für jede Stimme - Passacaglia - Da Capo des Eingangssatzes. Dabei sind die Soli von Violine 1 und Fagott identisch im Notentext, aber auf unterschiedliche Bässe gesetzt. Die Soli von Violine 2 und Viola sind, abgesehen von der Oktavierung, identisch. Die Bezeichnung „Viola da Brazzo" ist mit Viola gleichzusetzen.
Eine eigene Violone-Stimme existiert nicht, sondern nur die bezifferte Bass-Stimme für den Organisten. Auf eine Verstärkung des Basso continuo sollte bei der Aufführung jedoch nicht verzichtet werden, da das Fagott thematisch eingebunden ist und streckenweise pausiert. Der Universitätsbibliothek Uppsala danke ich für die freundliche Genehmigung zur Veröffentlichung und Herrn Dr. Lars Berglund für die freundliche Beratung bei der Datierung der Sonate.
Klaus-Jürgen Gundlach Templin, im März 2010
Aufführungsdauer: ca. 16 Minuten